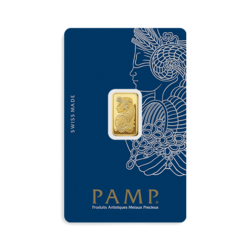Der Herbst verspricht in den Vereinigten Staaten turbulent zu werden. Die US-Notenbank Fed dürfte zum ersten Mal seit fünf Jahren ihre Zinsen senken. Angesichts der weiterhin schwachen Arbeitsmarktdaten, der nach wie vor drohenden Rezession und der wachsenden Unsicherheit infolge des Handelskrieges zeigt diese Entscheidung vor allem, dass sich der langfristige Finanzzyklus in den Vereinigten Staaten seinem Ende zuneigt.
Trumps Politik ist kein Zufall. Wenngleich ihm nur eine eng begrenzte Zeit zur Verfügung steht, versucht amerikanische Präsident den Lauf der zu kontrollieren. Mit der Rückkehr zum Protektionismus verfolgt er ein einziges Ziel: die Bewahrung der amerikanischen Hegemonie. Er weiß, dass diese im Niedergang begriffen ist und dass ihr Ende nahe ist, wenn nichts unternommen wird, um dies zu verhindern. Aus finanzieller Sicht sind viele Indikatoren im roten Bereich: Die Staatsverschuldung hat kürzlich die Marke von 37 Billionen Dollar überschritten, was 108.000 Dollar pro US-Bürger entspricht. Das Haushaltsdefizit beträgt 8 % des BIP, und die langsame Entdollarisierung der Welt verhindert, dass das Land sein Defizit unbegrenzt ausweiten kann. Auch das Handelsdefizit ist mit 1,2 Billionen Dollar beträchtlich und zeigt, dass die Vereinigten Staaten mittlerweile doppelt so viel importieren wie exportieren. Die Unternehmensinsolvenzen haben im letzten Jahr ebenfalls um 20 % zugenommen, so viel wie nie zuvor. Die Gesamtverschuldung der amerikanischen Haushalte erreicht mit 17,5 Billionen Dollar ein Rekordniveau, wobei die Kreditkartenschulden mit 1,3 Billionen Dollar höher sind als je zuvor und die durchschnittlichen Zinssätze über 20 % betragen. Die Hypothekenzinsen liegen im Durchschnitt bei mehr als 7 %, was den Zugang zu Wohnraum weiter erschwert. Das Durchschnittsalter für den Immobilienkauf in den Vereinigten Staaten beträgt heute 56 Jahre, während es 1981 noch bei 31 Jahren lag. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die Sparquote der Haushalte auf 3,5 % gesunken ist, d. h. auf das Niveau der Finanzkrise von 2008.
Auf der anderen Seite geht es den US-Märkten jedoch bestens, da die Schulden der einen die Vermögenswerte der anderen sind. Die beiden wichtigsten Indizes, der S&P500 und der Nasdaq, verzeichnen aufgrund neuer Wachstumswerte weiterhin Höchststände. Und die Gesamtmarktkapitalisierung der Unternehmen des Landes beläuft sich auf über 45 Billionen Dollar, was fast 170 % des BIP entspricht. Schließlich bleiben die Vereinigten Staaten weiterhin das bevorzugte Anlageziel für die weltweiten Ersparnisse.
Diese ausufernde Finanzialisierung hinterlässt jedoch Spuren. Abgesehen von den sozialen und politischen Folgen haben sich die Vereinigten Staaten zunehmend deindustrialisiert. Seit mehreren Jahrzehnten fließen Bankkredite hauptsächlich in den Kauf von Finanzanlagen (Immobilien, Aktien usw.) und nicht in produktive Investitionen. Heute macht die Produktion von Gütern nur noch 10 % des BIP des Landes aus, der Rest entfällt auf Dienstleistungen. Diese erzeugen jedoch im Gegensatz zu Gütern nur einen sehr geringen realen Wert. Ein solches Modell kann daher nicht als nachhaltig angesehen werden. Aus diesem Grund greift Trump in einer von Knappheit bestimmten Welt auf den Protektionismus zurück, um die USA wieder zu einer Industriemacht zu machen.
Dieses Ziel scheint jedoch in Gefahr zu sein, da die Umformung einer finanzbasierten Wirtschaft in eine industriebasierte Wirtschaft in diesem Sinne nur schwer umsetzbar ist. Schließlich war es genau diese Finanzialisierung des Landes, die zu seiner Deindustrialisierung geführt hat, da sie Kapital eher in kurzfristig profitable Werte lenkt als in Sektoren, die mit produktiven Investitionen verbunden, wenig rentabel oder zu kostspielig sind. Darüber hinaus reicht die Deindustrialisierung der USA nicht nur mehrere Jahrzehnte zurück, sondern parallel dazu haben sich auch die Wertschöpfungsketten von West nach Ost verlagert, insbesondere in die neuen asiatischen Tigerstaaten, wo die Arbeitskosten nach wie vor besonders niedrig sind. Zudem findet die Produktion vieler wichtiger Industriekomponenten (Halbleiter, Batterien, Seltene Erden usw.) heute überwiegend außerhalb der Vereinigten Staaten statt, insbesondere in Asien. Dies hat in einem globalen Wettlauf um Ressourcen zu geopolitischen Spannungen zwischen den Großmächten geführt, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten und China. Schließlich ist selbst in der Industrie die Produktion heute stark automatisiert und schafft weit weniger Arbeitsplätze als früher. Im Jahr 1980 machte die Beschäftigung in der Industrie 20 % des BIP des Landes aus, heute sind es weniger als 8 %. Der Versuch, die alten Fabrikarbeitsplätze wie in vergangenen Zeiten zurückzubringen, ist ein illusorisches Ziel, das die Wettbewerbsfähigkeit des Landes schwächen könnte.
Diese Politik könnte dennoch die Unterstützung der US-Notenbank finden. Mit gezielten Finanzierungen und einer Neuausrichtung der Kredite auf die Industrie, insbesondere durch den Ausbau der Regionalbanken, könnte die Fed Trumps Protektionismus fördern. Aber die Notenbank, die durch die Grenzen ihres Mandats eingeschränkt ist, erduldet diese Politik eher, als dass sie sie aktiv unterstützt. Da die Inflation nicht mehr unter 2 % sinkt, wird die Einführung von Zöllen den Preisdruck verstärken, was das Erreichen des Inflationsziels erschwert und zu mehr Unsicherheit an Märkten führen wird. Zumal Trump die Fed zu einer weiteren Senkung der Zinsen drängt – und gleichzeitig seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, den Präsidenten der Fed zu ersetzen. Dies birgt die Gefahr, eine neue Inflationsspirale auszulösen... Die zwei bis drei Zinssenkungen, die in den kommenden Monaten erwartet werden, würden diesen Trend zusätzlich verstärken.
Wenngleich Trumps Ambitionen voller Widersprüche sind, lässt sich seine Politik nur durch eine langfristige Analyse verstehen. Während ihr die finanziellen Herausforderungen über den Kopf wachsen und die führende Weltmacht in dem Bewusstsein lebt, dass ihre Hegemonie bedroht ist, vermischen sich Unstimmigkeiten mit der Anwendung von Gewalt, die zur letzten Option wird. Dies ist das Eingeständnis einer Vertrauenskrise im Land, einer ausgeprägten Ohnmacht. Daher der Beginn eines Handelskrieges gegen den Rest der Welt, die Sanktionen gegen andere Staaten, der Austritt aus internationalen Organisationen usw. Aber die negativen Folgen dieser Maßnahmen sind bereits zu erkennen. Die Politik der Vereinigten Staaten erscheint in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv: Der Dollar verliert kontinuierlich an Wert. Während Trump die Attraktivität des Landes stärken will, wenden sich ausländische Investoren von der amerikanischen Währung ab. Dies geht so weit, dass die Zentralbanken heute mehr Gold als US-Staatsanleihen halten... Und die Goldkäufer befinden sich auf der anderen Seite des Planeten, im Osten, wo sie die Konturen einer neuen Welt zeichnen, wie das jüngste Treffen der Präsidenten Indiens, Chinas und Russlands auf dem SCO-Gipfel zur Stärkung ihrer Beziehungen erneut gezeigt hat.
Ausländische Zentralbanken halten erstmal seit 1996 mehr Gold als US-Staatsanleihen @TaviCosta pic.twitter.com/NB0znkXAef
— GoldBroker (Deutschland) (@Goldbroker_DE) August 28, 2025
Die amerikanische Politik wird also nichts daran ändern, dass sich das Land weiter in einer Illusion von Stabilität wiegt, getragen von der Allmacht seines Finanzsektors, der nur auf Kosten der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter voranschreitet. Dieser Kontrast war in allen Ländern zu beobachten, die eine Phase der Hegemonie erlebt haben, vom Italien des Mittelalters über die Niederlande während der Renaissance bis hin zum England der industriellen Revolution. Alle erlebten das gleiche Ende: sie erreichten monetäre und militärische Hegemonie, welche jedoch mit dem Aufstieg neuer Mächte zunehmend schwächer wurde. Denn jeder Fall bringt eine neue Herrschaft hervor, jede Krise Hoffnung, jede Schöpfung Zerstörung...
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.