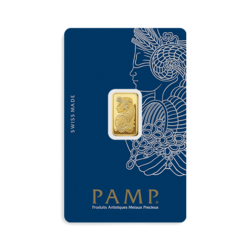Vor über einem halben Jahrhundert haben die USA das Vereinigte Königreich als dominante internationale Großmacht abgelöst. Ihre militärische und monetäre Stärke, die beiden wichtigsten Machthebel jedes hegemonialen Staats, bleiben ohnegleichen. Die Regierung von Joe Biden will den Rang der USA als Supermacht erhalten, doch die Welt ist im Wandel. Globalisierung wird von Protektionismus abgelöst, der Preis des Geldes steigt, die Illusion einer internationalen Friedensordnung macht der Instabilität Platz und die Demokratie wird geschwächt und Schritt für Schritt durch Autoritarismus ersetzt.
Auf den ersten Blick erzeugt die amerikanische Wirtschaft den Anschein von Stabilität.
Die Inflation bleibt hartnäckig
Die Herausforderungen wachsen und vermehren sich, sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene. In diesem sich neu herauskristallisierendem Kontext, der die Welt von morgen erahnen lässt, ist die Inflation in den USA wie auch anderswo zur Realität geworden. Seit dem Beginn von Bidens Amtszeit als Präsident sind die Verbraucherpreise um fast 20 % gestiegen und besonders Grundbedarfsartikel haben sich stark verteuert. Wie erwartet sinkt die Inflationsrate nicht auf 2 %, sondern stabilisiert sich auf erhöhtem Niveau. Die Produktionskosten, die einen Ausblick auf die künftige Preisentwicklung geben, steigen sogar wieder. Und wie andere Zentralbanken auch, versucht die Federal Reserve unterdessen die realen Kreditkosten so niedrig wie möglich zu halten, um die Last der Schulden zu begrenzen – zum Preis der Verarmung der privaten Haushalte.
Wenngleich die Inflation weltweit erhöht bleibt, zeigt ein Blick auf den Energiesektor, dass der Ölpreis auf der anderen Seite noch erstaunlich niedrig ist. Insbesondere in Zeiten der Energiekrise und der geopolitischen Spannungen. Während der Krieg im Gazastreifen bereits mindestens 36.000 Menschen das Leben gekostet hat, könnten die ölfördernden Staaten wie Russland, Saudi-Arabien, China und der Iran ohne Weiteres beschließen, einen Ölpreisschock zu provozieren. Doch ihre nationalen Interessen scheinen den Vorrang zu haben. Zudem stimmen zahlreiche Mitglieder der Organisation der ölexportierenden Länder ebenso wie die BRICS-Staaten in vielen Angelegenheiten nach wie vor mit den Positionen der westlichen Nationen überein. In dieser Hinsicht müssen sich die USA nur wenige Sorge machen.
Die Stärke des Dollars rettet die Finanzlage
Bislang konnten die Vereinigten Staaten eine Rezession dank einer beispiellosen Haushaltssituation verhindern. Eine restriktive Geldpolitik ist an die Stelle von massiven Investitionspaketen wie dem Chips Act, dem Infrastructure and Jobs Act oder dem Inflation Reduction Act getreten. Diese Programme hatten die verfügbare Liquidität erhöht, während die Wiederanhebung der Zinsen den umgekehrten Effekt hat. Der Arbeitsmarkt, angekurbelt von dieser finanziellen Unterstützung, zeigt sich äußerst widerstandsfähig. Das Wachstum wird erneut gestärkt. Nach Angaben des IWF wird die US-Wirtschaft in diesem Jahr fast doppelt so stark wachsen wie die der anderen G7-Staaten. Für 2024 wird ein Plus von 2,7 % erwartet, für 2025 ein Plus von 1,9 %.
Diese gesunde Konjunktur, die durch die Haushaltspolitik ermöglicht wird, gründet zum großen Teil auf dem internationalen Vertrauen in den Dollar. Denn die starke weltweite Nachfrage nach der US-Währung erlaubt dem Land die Ausweitung seiner öffentlichen Ausgaben, ohne dass der Dollar an Wert verliert. Doch diese Hegemonie beruht auch auf der großzügigen, weltweiten Verteilung des Dollars. Die Zinserhöhungen werden den Zugang zur amerikanischen Währung nun jedoch einschränken. Und die fortschreitende Entdollarisierung der Welt zwingt die USA, oder genauer gesagt die Fed, ihren Leitzins weiter anzuheben, damit der Dollar trotzdem attraktiv bleibt. Dieser Trend bleibt nicht ohne Folgen: Die Last des Schuldendienstes nimmt kontinuierlich zu (die Zinszahlungen der USA betragen mittlerweile mehr als 1 Billion Dollar im Quartal), die Staatsverschuldung beläuft sich auf 35 Billionen Dollar und das Haushaltsloch entspricht 7,5 % des BIP.
Finanzielle Herausforderungen an mehreren Fronten
Die US-Wirtschaft befindet sich in einem Rennen gegen die Zeit. Wie jedes Imperium, das unweigerlich dem Untergang geweiht ist, versuchen die Vereinigten Staaten diesen Tag hinauszuzögern, indem sie neue Schuldverschreibungen – ein Instrument zur Kontrolle der Zeit – ausgeben.
Mittelfristig kann sich die finanzielle Lage der USA nicht wirklich verbessern. Diejenigen, die meinen, dass die Ära der Niedrig- und Negativzinsen zurückkehrt, sind auf dem Holzweg. Wenngleich mehrere Zinssenkungen zur Unterstützung der US-Wirtschaft zu erwarten sind, hat die Zinsrevolution gerade erst begonnen und wird die Rahmenbedingungen des amerikanischen Finanzsystems neu definieren. Dies gilt umso mehr, da der anhaltende Inflationsdruck ein langfristig erhöhtes Zinsniveau erfordert.
In dieser neuen Wirklichkeit sieht sich die Regierung von Joe Biden nun mit verschiedensten finanziellen Problemen konfrontiert, von der Volatilität des Anleihemarkts über den Sektor für Gewerbeimmobilien bis hin zu Privatverschuldung und den Wertschwankungen des Dollars. Der höhere „Mietpreis“ des Geldes verstärkt den finanziellen Druck auf private Haushalte und Unternehmen, aber auch auf kleine und mittelgroße Banken, die einen abrupten Einbruch ihrer Erträge verbuchen. Wenngleich das beispiellose Unterstützungspaket Bank Term Funding Program (BTFP) dem amerikanischen Finanzsystem als Rettungsring diente, ist seine Rolle mittlerweile begrenzt, da die Kreditvergabe im Rahmen des Programms im März beendet wurde.
Volatilität und leichte Eintrübung an den Märkten
Das Wachstum wird zudem durch die starke Konzentration des amerikanischen Bankensystems eingeschränkt. Die rückläufige Zahl der Banken begrenzt die Kreditvergabe und führt zur Schwächung der Wirtschaftsaktivität und der Industrie. Da die kleinen und mittelgroßen Banken in den USA rund 50 % aller Kredite vergeben, führt ihr Verschwinden zur Verringerung des Geldumlaufs in der Wirtschaft.
Kurzfristig mildert diese Konzentration auch die Volatilität an den Aktienmärkten. Die wichtigsten US-Aktienindizes basieren heute mehr denn je auf der Performance der größten Unternehmen sowie auf den Erwartungen, die an die künstliche Intelligenz geknüpft sind. Die Technologiewerte, die seit Jahresbeginn um fast 30 % zugelegt haben, heben auch die Indizes mit nach oben. Fast 80 % der Performance des S&P 500 stammt von Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet... Einige andere Unternehmen wie Nvidia, das mittlerweile mit 2,8 Billionen US-Dollar bewertet wird, spielen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle und helfen dabei, die Schwierigkeiten anderer Branchen zu kaschieren.
Andererseits nehmen die Spannungen am internationalen Währungsmarkt seit einigen Wochen zu, da insbesondere der Yen und der konkurrierende Renminbi schwächer werden. Japan hat seit Anfang Mai die Rekordsumme von 9,8 Billionen Yen (62 Milliarden Dollar) ausgegeben, um seine Währung zu stützen, die auf den niedrigsten Stand seit 34 Jahren gefallen ist. China scheint unterdessen eine Abwertung des Renminbis anzustreben, um das Wachstum anzukurbeln (obwohl das Land gleichzeitig immer mehr US-Anleihen abstößt). Geopolitische Spannungen sind ein weiterer Grund für die starken Schwankungen der Wechselkurse (die übrigens oft miteinander in Verbindung stehen).
Darüber hinaus orientieren sich die Zentralbanken zwar weiterhin an der Geldpolitik der Fed, doch könnte die Konjunkturabschwächung in vielen Ländern zu Zinssenkungen führen, wie sie beispielsweise von der EZB im Juli erwartet werden.
Der Anleihemarkt steht weiterhin am stärksten unter Druck. Hochwertige US-Unternehmensanleihen im Wert von fast 10 Milliarden Dollar laufen Gefahr, zu „Junk Bonds“ („faule Anleihen“) degradiert zu werden. Dies wird sich auf die Kreditspreads auswirken, d. h. die Differenz zwischen dem Zinssatz für Unternehmens- und Staatsanleihen. Insbesondere, da die USA heute Kredite zu Bedingungen aufnehmen, wie sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr vorgekommen sind. Der 10-Jahres-Referenzzins liegt mittlerweile bei 4,5 %, was die Aufgabe der Fed zusätzlich erschwert.
Diese Volatilität spiegelt auch die tatsächlichen Erwartungen bezüglich der Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten wider. Da die Inflationsrate seit Anfang des Jahres die Vorhersagen übertrifft, schwindet die Hoffnung der Anleger auf eine Zinssenkung. Ein solcher Schritt der Zentralbank wäre jedoch nur ein Beweis für ihr Unvermögen, die Inflation zu bekämpfen, und angesichts der bevorstehenden US-Wahlen ebenso sehr von wirtschaftlichen und finanziellen wie von politischen Erwägungen geleitet.
Das Zentrum aller Probleme: Politische Ungewissheit
Im letzten Bericht der Fed zur Finanzstabilität beleuchtet die US-Notenbank verschiedene Aspekte, indem sie insbesondere die Bewertung von Aktiva, die Kredite der Unternehmen und Haushalte, den Hebeleffekt und Finanzierungsrisiken analysiert. Das größte Risiko bleibt jedoch die politische Ungewissheit, wie die Aussagen der Investoren bezeugen. Die zunehmende Ungewissheit, die verstärkt wird durch die Eskalation geopolitischer Spannungen und den Handelskrieg, wie er vor allem von China geführt wird, reduziert die Investitionen und animiert die Haushalte zum Sparen.
Dieses historische Wahljahr, in dem die Bürger von Ländern, die gemeinsam rund die Hälfte des globalen BIP repräsentieren, an die Wahlurnen gerufen werden, hat die Märkte bislang nicht destabilisiert. Die wichtigsten Wahlen fanden in Schwellenländern statt, wo die bisherigen Amtsinhaber in den meisten Fällen wiedergewählt wurden. Mögliche Veränderungen könnte es nur in den westlichen Staaten geben, in den USA, in Europa oder im Vereinigten Königreich. Die politische Landschaft wird fraglos umgestaltet werden, doch für die finanzialisierte Wirtschaft ist das kaum von Bedeutung. Die Erinnerung an Liz Truss, deren an Margaret Thatcher angelehnte Politik nur wenige Tage Bestand hatte, zeigt, dass die Wirtschaft heute nicht mehr der Politik untergeordnet werden kann. Der Markt ist so mächtig geworden, dass selbst die radikalsten Entscheidungsträger sich schließlich beugen müssen.
Die wirtschaftlichen Aussichten der USA werden unterdessen weiterhin von der Geldpolitik der Fed bestimmt, deren Entscheidungen in erster Linie durch den Wunsch geleitet werden, die zu erwartende Finanzkrise hinauszuzögern. Doch die US-Wirtschaft ist auch abhängig von der Neuausrichtung der internationalen Gleichgewichte, denn die Welt wandelt sich mit nie gesehener Geschwindigkeit und die USA müssen heute mehr den je fürchten, ihren Status als Supermacht zu verlieren.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.