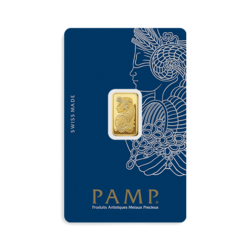Frankreich durchlebt eine kritische Phase seiner Geschichte. Die Regierungskrise von 1958 war zweifellos ein bedeutsames Ereignis, doch die Krise, die das Land heute erschüttert, ist von anderer Tragweite, da sie sich vor dem Hintergrund einer Welt im Umbruch abspielt. Zur Demokratie- und Politikkrise gesellt sich nun auch noch die Möglichkeit einer Finanzkrise. Die Märkte beginnen, das Land zu sanktionieren, das sich nun auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Frankreich ist nach wie vor der einzige Staat der Eurozone, der gleichzeitig vier Defizite aufweist (Haushalt, Handelsbilanz, Primärhaushalt und Zahlungsbilanz), und ist zudem am höchsten verschuldet.
„Die Politik Frankreichs wird nicht an der Börse gemacht“, erklärte General de Gaulle 1959, um daran zu erinnern, dass die Nation in wirtschaftlichen Fragen vollständig souverän bleiben muss. Wenn man jedoch die Entscheidungen des ehemaligen Premierministers François Bayrou betrachtet, fragt man sich, was aus dem Erbe des Generals geworden ist. Im Laufe des Sommers wurde ein Sparplan in Höhe von 44 Milliarden Euro vorgelegt, der verschiedene Haushaltskürzungen (im Bereich der Staatsverwaltung, der lokalen Gebietskörperschaften, des Gesundheitswesens und andere unpopuläre Maßnahmen wie die Streichung von zwei Feiertagen...) vorsieht. Das einzige Ziel dabei war im Grunde genommen, das Vertrauen der Gläubiger zu bewahren. Im Gegensatz zur Zeit von Charles de Gaulle, als Frankreichs Staatsschulden nur 30 % des BIP entsprachen, beträgt die Verschuldung heute 110 % des BIP. Der Schlüssel zu Frankreichs Schicksal liegt nicht mehr allein in seinen eigenen Händen.
Dieser Wandel vollzog sich im Laufe der Jahrzehnte. Seit Frankreich 1973 aufgehört hat, Kredite bei seiner Nationalbank aufzunehmen, seit es sich in den 1980er Jahren der finanzialisierten Wirtschaft angeschlossen hat und seit es Anfang der 2000er Jahre begonnen hat, seine Schulden in einer supranationalen Währung zu emittieren und darüber hinaus hauptsächlich Kredite bei ausländischen Investoren aufzunehmen, hat es jeglichen Einfluss verloren. Die aufeinanderfolgenden Regierungen haben daraufhin die Staatsschulden kontinuierlich erhöht, unter dem Vorwand, dass eine solche Politik den Sozialstaat bewahren würde, und mit der Versicherung, dass der Schutzschirm des Euro und der EZB immer vorhanden sei. Die Zentralbanken der Eurozone arbeiten heute jedoch mit negativem Eigenkapital (nach den wiederholten Rettungsaktionen der EZB), und der Euro verliert kontinuierlich an Wert...
Das große Problem Frankreichs besteht unter diesem Blickwinkel nicht darin, dass es zu viel ausgibt, sondern dass es sich zu stark verschuldet hat. Denn gerade weil Frankreichs Schulden so hoch sind, sind auch die Ausgaben so immens. Emmanuel Macron trägt hierfür die Hauptverantwortung, da er die Verschuldung um mehr als ein Drittel erhöht hat, um im Wesentlichen seine Wiederwahl zu sichern und den Zorn der Bürger zu besänftigen. Es gibt unzählige Beispiele für Länder mit hohen Ausgaben, aber moderaten Schulden (Norwegen, Schweden, Luxemburg, Finnland ...). Es gibt jedoch kein Land mit hohen Staatsschulden, dessen Ausgaben nicht ebenfalls sehr hoch sind (mit Ausnahme Japans, das fast 100 % seiner eigenen Schuldverschreibungen hält). Dieses Phänomen hat seinen Grund: Je mehr sich ein Land verschuldet, desto stärker konzentriert sich der Reichtum im Land und desto größer werden die Ungleichheiten, was steigende Sozialausgaben zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität erfordert. Darüber hinaus verschlechtern sich die Wachstumsaussichten, da die Staatseinnahmen zunehmend in Bereiche fließen, die keinen Wohlstand schaffen. In dieser Hinsicht gehört Frankreich zu den schlechtesten Schülern der Eurozone.
Die nächste Regierung wird also hauptsächlich damit beschäftigt sein, die Fehler der vergangenen Politik wiedergutzumachen. Da jedoch keine Mehrheit zu finden sein dürfte, besteht die Gefahr, dass das Land bis 2027 blockiert bleibt... Hinzu kommt die Wut der Bevölkerung, wie die Bewegung „Bloquons tout” zeigt. Und heute kann der soziale Frieden nicht mehr wie während der Pandemie mit der Verteilung von Schecks aller Art erkauft werden.
Diese Phase der politischen Unsicherheit verhindert das Verabschieden eines Haushaltsplans und sorgt für Unruhe an den Märkten. Wäre die Verschuldung Frankreichs gering oder zumindest moderat, ließe sich die Situation wieder unter Kontrolle bringen. Aber durch Staatsschulden von mehr als 3,3 Billionen Euro nimmt die Unsicherheit zu und die Zinssätze schnellen in die Höhe. Frankreich nimmt nunmehr zu durchschnittlich höheren Kosten als Griechenland und zu höheren Kosten als während der Staatsschuldenkrise Kredite auf. Das zeigt, wie ernst die Lage ist. Unter diesen Umständen könnten die Zinskosten, die bereits mehr als 60 Milliarden Euro pro Jahr betragen, bis 2029 auf 110 Milliarden Euro steigen.
Die Situation kann sich zudem schnell zuspitzen. Zunächst muss die Ratingagentur Fitch am 12. September ihr Urteil über die Bonität Frankreichs fällen. Angesichts der aktuellen Lage und des historischen Volumens der in diesem Jahr ausgegebenen Staatsanleihen ist eine Herabstufung der französischen Bonität von AA- auf A sehr wahrscheinlich, was zu einem weiteren Anstieg der Zinssätze führen würde. Zweitens sorgt der Rücktritt der Regierung für eine Welle der Unsicherheit im Land, die einen Angriff der Märkte gegen die französischen Staatsanleihen auslösen könnte. Am Ende eines Zyklus, wie es derzeit der Fall ist, gehen politische Probleme immer auch mit finanziellen Schwierigkeiten einher. Das Risiko einer Finanzkrise im Land ist nicht auszuschließen, auch wenn ein Eingreifen ausländischer Institutionen in der siebtgrößten Wirtschaftsmacht der Welt noch nicht unmittelbar bevorsteht.
Die Eurozone wäre davon am stärksten betroffen. Eine solche Schwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU würde sich auf alle europäischen Länder auswirken. Der Kontinent befindet sich bereits in einer Phase extremer Instabilität, da die Globalisierung, auf der die Europäische Union aufgebaut ist, in Auflösung begriffen ist. Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit der Mitgliedstaaten könnten die Folgen in allen Bereichen spürbar werden: zunächst für die europäischen Banken, die gegenüber französischen Schulden stark exponiert sind, dann anhand des Eurokurses, des Wachstums in Europa, des Vertrauens der Märkte in die Europäische Union und sogar anhand der Stabilität ihrer Institutionen.
Auch die Ersparnisse der Franzosen sind betroffen. Die Sparquote in Frankreich nimmt bereits zu und hat mit fast 19 % einen historischen Höchststand erreicht, der mit den 1980er Jahren vergleichbar ist und zum ersten Mal seit 2000 über dem Wert in Deutschland liegt. Dieser Trend lässt sich durch die Verschlechterung der finanziellen Lage und die politische Instabilität, aber auch durch drohende Steuererhöhungen erklären. Die Unsicherheit ist also die Hauptursache dafür, dass die Franzosen sparen, um sich für eine ungewisse Zukunft zu wappnen. In diesem Zusammenhang dürfte Gold natürlich eine zentrale Rolle spielen.
Während die Nachfrage nach dem gelben Metall heute weiterhin von institutionellen Anlegern, insbesondere Zentralbanken, gestützt wird, zeichnet sich ein neuer Trend ab. Anleiherenditen verlieren an Wert, und aufgrund der Inflation nimmt die Kaufkraft der Währungen immer weiter ab... Die Risiken im Zusammenhang mit dem staatlichen Handeln haben zur Folge, dass Sparer und Investoren sich sicheren Anlagen zuwenden, darunter physisches Gold (Barren und Münzen). Dies umso mehr, als politische Instabilität – wie beispielsweise in Frankreich – die Anleger dazu bringt, sich von Vermögenswerten zu distanzieren, die von staatlichen Entscheidungen abhängig sind (insbesondere seitdem die Debatte über eine Umschichtung der finanziellen Rücklagen in Richtung Staatsanleihen zunimmt). Wie viele andere Krisenländer könnte auch Frankreich vor einer tiefgehenden Umschichtung der nationalen Ersparnisse stehen.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.