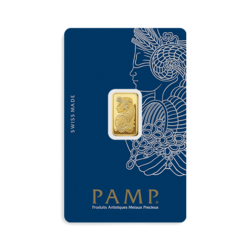Der Gipfel von Busan sollte die wirtschaftliche Aussöhnung zwischen den beiden größten Weltmächten symbolisieren. Das Weiße Haus sprach von einem „historischen Abkommen” und die amerikanischen Medien griffen den Begriff „Abkommen” auf, ohne zu erwähnen, dass kein Text unterzeichnet worden war. Alles beruhte auf mündlichen Versprechungen und einer sorgfältig arrangierten Inszenierung.
Peking seinerseits veröffentlichte keine offizielle Bestätigung: Weder das Handelsministerium MOFCOM, noch die Volksbank, noch die für Agrarimporte zuständige staatliche Behörde COFCO, griffen die von Washington erwähnten Verpflichtungen auf. Die einzige Spur des angeblichen „Deals” ist eine amerikanische Pressemitteilung, in der Zugeständnisse hervorgehoben werden, die auf chinesischer Seite nirgendwo in den offiziellen Aufzeichnungen zu finden sind.
Der Agrarsektor sollte das Aushängeschild dieser Annäherung sein: 12 Millionen Tonnen Soja sollte China ab Ende 2025 von den USA kaufen, dann 25 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2028. Einige Tage lang glaubten die Märkte daran. Die Sojapreise erholten sich, die Händler im Mittleren Westen begrüßten eine Rückkehr der chinesischen Nachfrage, und Trump sprach von einem vollständigen Sieg für die amerikanischen Landwirte. Doch die Realität holte sie schnell ein. Nach einer einzigen Lieferung Anfang November stellte China die Einkäufe ein. Seitdem gingen keine neuen Bestellungen mehr ein, und das Handelsvolumen fiel innerhalb von weniger als zwei Wochen wieder auf null. Wie so oft ließ Peking Washington sich selbst beglückwünschen, bevor es den Hahn zudrehte.
In Bezug auf kritische Metalle war die Kommunikation ebenso irreführend. Trump kündigte die Aufhebung der chinesischen Exportbeschränkungen für Seltene Erden an. China hat jedoch gar nichts aufgehoben. Es hat lediglich ein neues System eingeführt, das sich an der amerikanischen Praxis orientiert: das Validated End-User System. Dieser Mechanismus unterscheidet zwischen zivilen Unternehmen, die Seltene Erden, Magnete oder strategische Legierungen importieren dürfen, und solchen, die dem amerikanischen Militär-Industrie-Komplex angehören und nun ausgeschlossen sind. In der Praxis können Tesla, Apple oder Boeing (zivile Version) weiterhin die benötigten Materialien erhalten, während Lockheed Martin, Raytheon, Northrop oder SpaceX Defense nicht mehr beliefert werden. Peking hält sich an den Wortlaut seines Versprechens – die Erleichterung von Exporten – verändert jedoch dessen Sinn: Es liefert, entscheidet aber selbst, an wen.
Gleichzeitig hat China seine Kontrolle über andere strategische Metalle verschärft. Am 30. Oktober veröffentlichte das MOFCOM das Rundschreiben 2025-68, das den Export von Wolfram, Antimon und Silber für den Zeitraum 2026-2027 regelt. Offiziell geht es dabei um den „Schutz der Ressourcen und der Umwelt”. Tatsächlich zwingen diese neuen Vorschriften den exportierenden Unternehmen ein staatliches Genehmigungsverfahren auf, das es Peking ermöglicht, von Fall zu Fall über Mengen und Empfänger zu entscheiden. Silber, das in der Elektronik und in Solarzellen verwendet wird, wird damit in die Liste der strategisch wichtigen Metalle aufgenommen. China schließt seine Grenzen nicht, sondern wählt seine Kunden aus.
Während Trump stolz die Wiederaufnahme des Handels verkündete, unterzeichnete Peking parallel dazu ein Währungsabkommen über 400 Milliarden Yuan mit Südkorea und einen Fünfjahresplan für industrielle Zusammenarbeit. Der Kontrast ist frappierend: auf der einen Seite ein amerikanischer „Deal” ohne Text, auf der anderen Seite eine konkrete asiatische Partnerschaft, unterzeichnet, beziffert und veröffentlicht. Das war der wahre Grund für Xi Jinpings Reise nach Korea: die Zahlungskreisläufe in Yuan zu stärken und die regionale Integration in Finanzfragen zu beschleunigen, während Washington sich diplomatischen Illusionen hingibt.
Zwei Wochen nach Busan bleibt also nur eine leere Kulisse zurück: nicht gehaltene Versprechen, eingefrorene Agrarströme, ein Filtersystem für Seltene Erden und neue Beschränkungen für kritische Metalle. Die Märkte haben ein Foto gekauft, Kommentatoren haben eine Übereinkunft ohne Text hinausposaunt, und amerikanische Sojabohnen warten noch immer auf Abnehmer. China verfolgt damit seine Strategie der selektiven Abkopplung weiter: Es behält die Kontrolle über die Lieferketten in der Technologiebranche, sichert seine Ressourcen und macht keine irreversiblen Zugeständnisse. Washington hat ein Abkommen verkündet, Peking hat die Regeln geschrieben.
Trump hat zweifellos verstanden, dass seine Zölle in Höhe von 100 % auf chinesische Importe, die er als Wahlkampfwaffe einsetzte, der amerikanischen Wirtschaft direkt zu schaden begannen. Die lokalen Unternehmen, die bereits durch steigende Finanzierungskosten geschwächt waren, fürchteten die inflationären Auswirkungen weiterer Zollerhöhungen auf Zwischenprodukte und Konsumgüter. Tatsächlich war die beschwichtigende Geste gegenüber China kein ideologischer Kurswechsel, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit: Die Märkte verlangten ein Zeichen der Deeskalation, da andernfalls Liquiditätsengpässe und Misstrauen gegenüber US-Staatsanleihen drohten.
In dieser Hinsicht hat Trump den Gipfel von Busan geschickt genutzt. Er hat die perfekte Medienkampagne inszeniert: ein Treffen mit Xi Jinping im Zeichen der Versöhnung, triumphale Erklärungen zu einem „historischen Deal” und eine Rhetorik, die genau darauf abgestimmt war, die erwartete Euphorie an den Börsen auszulösen. Die Wall Street brauchte nur ein Foto, keinen Vertrag. Die Indizes stiegen sprunghaft an, der VIX brach ein, und die Nachricht von einem „Handelsfrieden zwischen China und den USA” reichte aus, um die Sorgen kurzfristig auszuräumen. Aber in Wirklichkeit gibt es keinen „Deal”: keinen Text, keine formelle Verpflichtung, keine Unterschrift.
Was hingegen besiegelt wurde, ist eine gewisse Entspannung. Nach mehreren Jahren offener technologischer Konfrontation haben die beiden Länder zumindest vorübergehend einen pragmatischeren Ton gefunden. China erklärt sich bereit, bestimmte Diskussionskanäle wieder zu öffnen und fünfzehn US-Unternehmen von seiner Exportkontrollliste zu streichen; die USA lockern ihre Zölle und setzen einige Maßnahmen des Handelsministeriums aus. Das ist bescheiden, aber ausreichend, damit die Märkte darin eine nachhaltige Wende sehen.
Trump hat sogar die Idee geäußert, 600.000 Studienplätze für chinesische Studenten an amerikanischen Universitäten zu schaffen – ein unerwarteter Vorschlag, der für seine Wählerbasis regelrecht provokativ sein dürfte.
Dies ist ein völliger Bruch mit seinen früheren Äußerungen zu H1-B-Visa und seinem Misstrauen gegenüber Ausländern. Der Präsident zeigt einmal mehr sein Talent, zu überraschen: Er wechselt ohne Übergang von Konfrontation zu ausgestreckter Hand, von nationalistischer Rhetorik zu Image-Diplomatie. Diese Zweideutigkeit, die seine MAGA-Wählerschaft verunsichert, beruhigt paradoxerweise die Wall Street: Solange Trump Spannungen abbauen und die Börsen ankurbeln kann, tritt politische Kohärenz in den Hintergrund.
Der Gipfel von Busan hat also kein konkretes Handelsabkommen hervorgebracht, aber er hat dem Markt das geboten, was er verlangte: Entspannungsrhetorik und das implizite Versprechen, die Eskalationskette zu unterbrechen. China verschärft unterdessen seine Exportkontrollen für Wolfram, Silber und Seltene Erden, während Trump die Illusion eines „Deals” nutzt, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Eine meisterhafter PR-Stunt, der zwar nichts an den Machtverhältnissen geändert hat, aber ausreichte, um Zeit zu gewinnen – und einige Punkte beim Nasdaq.
Es überrauscht daher kaum, dass der Goldpreis nach diesem „Nicht-Deal” wieder zulegen konnte. Die Anleger ließen sich nicht täuschen: Hinter der Fassade diplomatischer Beruhigung verbirgt sich die Realität einer fragmentierten, von strategischen Spannungen geprägten Welt, in der das Vertrauen in politische Versprechen schwindet. Gold reagiert nicht auf Rhetorik, sondern auf Substanz – und die hatte der Gipfel in Busan nicht zu bieten.
Die „Papiergold“-Positionen der Fonds wurden während der Liquiditätskrise im Oktober teilweise abverkauft, aber die physischen Goldkäufe hörten nie auf. Die Zentralbanken, insbesondere von China (+10 Tonnen), der Türkei (+15 Tonnen) und Indien, stocken ihre Goldreserven weiterhin auf. Selbst die Bank of Korea hat angekündigt, dass sie zum ersten Mal seit 2013 wieder Goldkäufe plant – ein langfristiges Signal aus einem Land, das sich historisch stark auf den Dollar gestützt hat. Der physische Handel in Shanghai und an der COMEX offenbart weiterhin sehr hohe Liefermengen: Im Oktober wurde für mehr als 58.000 Kontrakte die Lieferung beantragt. Das entspricht fast dem Doppelten der durchschnittlichen Mengen zu Jahresbeginn.
Dieses erneute Interesse am gelben Metall zeigt eines: Der Markt glaubt nicht an die Stabilität, die das Foto aus Busan verspricht. Die Episode des „Phantom-Deals” erinnert daran, dass sich die Handelspolitik von einem Tag auf den anderen ändern kann, dass die Zusagen nur für die Pressemitteilungen von Wert waren, und dass das Vertrauen in den Dollar nicht bedingungslos ist.
Jedes Anzeichen einer Entspannung zwischen Washington und Peking bedeutet eine Atempause für die Aktienmärkte, aber ein Alarmsignal für diejenigen, die wissen, dass der Handelsfrieden auf einer Inszenierung und nicht auf einem dauerhaften Gleichgewicht beruht.
Während der Handel mit Soja abrupt zum Stillstand kommt, strategische Metalle unter chinesischer Kontrolle bleiben und die Deeskalation der USA sich auf eine nicht unterzeichnete Erklärung beschränkt, findet Gold natürlich wieder zu seiner Rolle als Anker zurück. Nicht weil es vom Chaos profitiert, sondern weil es der einzige Vermögenswert ist, der weder einen Deal noch ein Versprechen braucht, um Vertrauen zu schaffen.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.