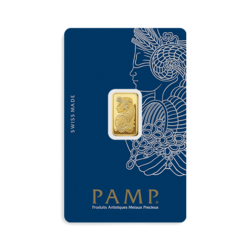Das Thema der europäischen Ersparnisse ist in aller Munde. Aus gutem Grund: Während die europäischen Staaten mit einer ausweglosen finanziellen Situation zu kämpfen haben, ist der Investitionsbedarf gleichzeitig so hoch wie nie zuvor. Nachhaltigkeit, Reindustrialisierung, Wettbewerbsfähigkeit, neue Technologien, Rüstung – die Herausforderungen sind zahlreich und kostspielig. Diese Investitionen, die im letzten Bericht von Mario Draghi auf 800 Milliarden Euro geschätzt werden, würden das Wachstum fördern und die Produktivität des Alten Kontinents wieder ankurbeln. Vor diesem Hintergrund könnte das Projekt zur Umlenkung der europäischen Ersparnisse in den kommenden Wochen also durchaus an Fahrt aufnehmen.
Die Rücklagen der Europäer gehören zu den größten der Welt. Die aus der Geschichte des Kontinents herrührende Angst vor dem Verrinnen der Zeit sowie die aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen (Überalterung der Bevölkerung, unflexibler Arbeitsmarkt, staatliche Zwänge...) veranlassen die Europäer zum Sparen. Die gesamten Ersparnisse in Europa werden auf 35,5 Billionen Euro geschätzt (diese Zahl kann je nach Studie etwas variieren), was rund 15 % des verfügbaren Einkommens der Haushalte entspricht (zum Vergleich: in den USA sind es nur 4 %). Gleichzeitig investieren die privaten Haushalte in Europa nur 3 % ihres Gesamtvermögens in Aktien, während dieser Anteil auf der anderen Seite des Atlantiks 30 % beträgt. Obwohl es sich dabei um eine Vertrauensfrage handelt, werden diese Ersparnisse hauptsächlich in ausländische Schuldtitel investiert, insbesondere in US-Treasuries, die die Europäer in immer größerem Umfang kaufen. Diese finanzielle Abhängigkeit vom Ausland ist ebenso einzigartig wie der Umfang der Rücklagen auf dem Alten Kontinent.
Auch die Sparrate bleibt in Europa trotz der Inflation hoch. Entgegen allen Erwartungen steigen die Preise und die Sparrate sogar gemeinsam. So lag die französische Sparquote im Jahr 2022 bei 15 % des verfügbaren Einkommens, während sie in diesem Jahr auf rund 18 % gestiegen ist. In Deutschland ist die Sparquote mit 20 % eine der höchsten in Europa. Im Allgemeinen griff vor allem die Mittelschicht auf ihre Ersparnisse zurück, um ihr Konsumniveau aufrechtzuerhalten, insbesondere in den Bereichen Freizeit, Reisen und langlebige Güter.
Mit anderen Worten: Selbst wenn die Preise weiter steigen (also der Euro per Definition weiter an Wert verliert), ziehen es die europäischen Haushalte vor, Geld beiseitezulegen, anstatt zu konsumieren. Trotz der oben genannten Faktoren ist dies vor allem auf die Unsicherheit auf dem alten Kontinent zurückzuführen (und nicht auf die hohen Zinssätze – diese sind in den letzten Monaten mehrfach gesunken). Während die USA seit Jahren ein relativ starkes Wachstum verzeichnen, mindert die wirtschaftliche Anfälligkeit Europas in Verbindung mit einer schwachen Regierungsführung (die Unsicherheit ist sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Natur) die Zuversicht der Haushalte und führt dazu, dass sie trotz Inflation sparen.
Ersparnisse in Europa: Welche Maßnahmen sind zu erwarten?
Da Europa gegenüber den finanziellen Entscheidungen der privaten Haushalte machtlos ist, setzt es nun auf das Projekt, die Ersparnisse umzulenken. Mehrere Lösungsansätze wurden vorgelegt. Zu diesen könnte ein verbesserter Zugang zu den Kapitalmärkten für mittelständische Unternehmen und Technologieunternehmen gehören, mittels einer echten Kapitalmarktunion. Die Wirkung dieser Maßnahme wäre jedoch begrenzt. Eine andere Möglichkeit wäre die Schaffung einer neuen europäischen Plattform, die diese Gelder anziehen soll, diesmal durch eine Spar- und Investitionsunion, wie sie kürzlich genannt wurde. Das Projekt des digitalen Euros der EZB, das aktuell im Eiltempo vorangetrieben wird, könnte übrigens dazu dienen, die Ersparnisse der Haushalte auf dieser Plattform anzulegen. Die Europäische Kommission setzt auch auf andere, innovativere Lösungen, wie eine Strategie zur Vermittlung von Finanzwissen und die Schaffung eines „Modells für gute Kontoführungspraktiken“. Basierend auf welchen Grundsätzen? Gute Frage. Zuletzt kann dieses Projekt auch zu einer einfachen, von den Bank- und Finanzinstituten beschlossenen Umschichtung dieses Kapitals in die Aktien börsennotierter europäischer Unternehmen führen. All diese Maßnahmen haben selbstverständlich einen zwanghaften, ja sogar autoritären Charakter. Zusammen mit dem Projekt einer großen gemeinsamen Anleiheemission ist dies eine der letzten Möglichkeiten für Europa, um Finanzmittel zu finden, während die Haushaltsdefizite und die Staatsverschuldung der europäischen Länder alarmierende Höhen erreichen.
Europa greift nicht zuletzt aufgrund seiner strukturellen Schwächen auf Lösungsansätze dieser Art zurück. Seine Institutionen, die dem Gemeinschaftsprojekt nicht gewachsen sind, mindern jede Handlungsfähigkeit. Für die Bewohner des alten Kontinents ist Sparen auch ein Mittel, um sich vor einem transnationalen Projekt zu schützen, das ihre persönliche Freiheit einschränken würde, einschließlich der Kontrolle und Entscheidungsgewalt über das eigene Vermögen.
In anderen Teilen der Welt stellt sich das Problem nicht in gleicher Weise. Zwar verfügen die USA nach wie vor über eine hegemoniale Finanzmacht, dank derer sie keine echten Finanzierungsprobleme kennen. Aber das gilt auch für China, das seinerseits über ausreichende Möglichkeiten verfügt, um den notwendigen Finanzierungsbedarf zu decken und sich gegen jegliche Krisen (insbesondere die aktuelle Immobilienkrise) abzusichern. Andere Länder, wie die neuen asiatischen Mächte, verfügen ebenfalls über einen sehr großen Spielraum und müssen nicht auf solche Maßnahmen zurückgreifen. Dies gilt auch für viele Schwellenländer, sei es Brasilien, Südafrika, die Golfstaaten usw. Eines der wenigen Länder der Welt, das dieses Instrument einsetzt, ist Japan, dessen Situation allgemein bekannt ist: Das Land der aufgehenden Sonne steckt seit dem Finanzcrash der 1990er Jahre in einer tiefen und langen finanziellen (aber auch institutionellen und sozialen) Krise, die entweder mit einem Erlass der Staatsschulden oder mit der Gründung einer neuen Zentralbank enden wird.
Eine neue Ära in der Vermögensverwaltung
Mit diesem Projekt stellt der Alte Kontinent in Gestalt der Europäischen Kommission und der EZB in Wirklichkeit seine Ohnmacht und seinen Dogmatismus zur Schau. Anstatt eine tiefgreifende Reform seiner Finanzstruktur, insbesondere seiner Geldpolitik (Verschuldung zum Nulltarif oder investitionsabhängige Zinssätze, Schaffung einer schuldenfreien Währung, Schwundgeld) oder seiner Steuer- und Haushaltspolitik (Angleichung zwischen den europäischen Staaten, Abschaffung der Steuerparadiese...) zu erwägen, verrennt Europa sich in ein Projekt, das seinen autoritären Charakter offenbart. In einer Zeit, in der Souveränität und Unabhängigkeit für jeden eine Notwendigkeit darstellen, und in der die Deglobalisierung in eine Krise gerät, schwimmt Europa gegen den Strom der Geschichte und der langfristigen Dynamiken, die doch seine Existenz begründen.
Angesichts eines solchen Vorhabens ist die Entscheidungsgewalt über die eigenen Ersparnisse mehr denn je von grundlegender Bedeutung. Umso mehr, als die europäischen Länder permanente Haushaltsdefizite aufweisen. Daher werden Wertpapiere, die an Staaten gebunden sind (Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Unternehmen mit staatlicher Beteiligung, bestimmte Sparpläne etc.) oder von diesen kontrolliert werden, immer unbeliebter. Unabhängige Vermögenswerte (Aktien, Rohstoffe, Gold usw.) gewinnen hingegen an Attraktivität und werden ihren aktuellen Aufwärtstrend fortsetzen. Insbesondere natürlich begrenzte Assets werden in einer Zeit, die das Ende des Überflusses einläutet, weiterhin aus der Masse herausstechen. Gold scheint aufgrund seiner limitierten Menge und seiner Rolle als sicherer Hafen immer noch der attraktivste Vermögenswert zu sein. Sein Preis stieg vor kurzem auf über 3.000 USD – seinen bisherigen Höchststand – und wird voraussichtlich auf diesem Niveau bleiben. Angesichts der Schwäche des US-Dollars und der bevorstehenden Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks könnte der Kurs sogar noch steigen. Der Wert der Anleiherenditen sinkt und treibt dadurch zusätzliches Kapital in Goldanlagen. Zudem werden die Zentralbanken angesichts der weltweiten geopolitischen Ungleichgewichte weiterhin Gold kaufen, was auch für Privatanleger einen zunehmenden Anreiz darstellt und dem gelben Metall zugutekommt.
Die Neuausrichtung der europäischen Ersparnisse wird auch in Zukunft ein aktuelles Thema bleiben, als die Haushalte planen, weiterhin Geld zurückzulegen. Dieses Vorhaben ist zwar auf den ersten Blick wenig bedeutsam, wird aber ernsthafte Folgen haben. Zum einen könnte es zu erheblichen Kapitalumschichtungen führen (zumal die EZB ihre Zinssenkungen wahrscheinlich fortsetzen wird), zum anderen aber auch die allgemeine Attraktivität der Region verringern. Schließlich könnte es die bereits angeschlagene europäische Demokratie zusätzlich schwächen…
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.