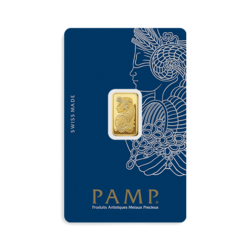Seit Jahresbeginn hat der US-Dollar bereits fast 10 % an Wert verloren und damit ein neues Tief erreicht.
Historisch gesehen ist ein Rückgang dieser Größenordnung selten: Man muss bis zur Gesundheitskrise im Jahr 2020 oder bis 2017 zurückblicken, um einen jährlichen Kursverlust von etwa 10 % zu finden. Der Unterschied besteht darin, dass die heutige Schwäche des Dollars nicht auf einen externen Schock zurückzuführen ist, sondern auf eine bewusste Maßnahme der Behörden zur Wahrung der Finanzstabilität. Mit anderen Worten: Der Dollar wird zum Ausgleichsinstrument eines Systems, das durch massive Verschuldung und den enormen staatlichen Finanzierungsbedarf in Bedrängnis gerät.

Der Markt hat nicht in Eigenregie gehandelt: Dieser Rückgang des Dollars wurde hauptsächlich von Washington aus orchestriert.
Die Vereinigten Staaten stehen heute vor einem ähnlichen Dilemma wie Japan. Einem überschuldeten Land bleiben nur zwei Optionen: entweder seine Währung abwerten zu lassen oder seinen Anleihemarkt leiden zu lassen. Japan hat seine Entscheidung längst getroffen: Die Bank of Japan hält die Zinsen künstlich sehr niedrig, indem sie massiv Schulden aufkauft, was zu einer starken Abwertung des Yen führt.
Zehn Jahre lang hat die BoJ ihre Zinsen durch umfangreiche Rückkäufe von Staatsanleihen künstlich nahe Null oder sogar im negativen Bereich gehalten. Mit dieser Strategie sollte ein Anstieg der Finanzierungskosten des japanischen Staates vermieden werden, dessen Verschuldung heute mehr als 250 % des BIP entspricht, der höchste Wert weltweit.
Diese anhaltende Unterstützung des Anleihemarktes hatte jedoch eine direkte Konsequenz: Der Yen brach ein. Da die japanischen Renditen künstlich auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten werden, investieren Anleger ihr Geld lieber in Währungen mit höheren Zinsen, wie den Dollar oder den Euro. Das Ergebnis: Kapital fließt ab, die Nachfrage nach Yen sinkt. In nur zehn Jahren hat die Währung mehr als 50 % ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt und einen seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenen Tiefstand erreicht.
Mit anderen Worten: Die BoJ hat sich dafür entschieden, ihre Währung zu opfern, um ihren Anleihemarkt zu schützen. Diese Entscheidung macht das Land jedoch anfällig: Die Importkosten explodieren, der Inflationsdruck steigt und das internationale Vertrauen in den Yen als sicheren Hafen ist ernsthaft erschüttert.

Die Vereinigten Staaten folgen nun dem gleichen Kurs wie Japan, indem sie sich bewusst dafür entschieden haben, den Dollar zu schwächen. Aber wie gehen sie dabei konkret vor?
Das US-Finanzministerium konzentriert sich auf die Emission sehr kurzfristiger Anleihen mit Laufzeiten von 4, 6 oder 8 Wochen. Indem es die Ausgabe dieser Anleihen vervielfacht, entzieht es dem Geldmarkt massiv Liquidität. Unter Berücksichtigung der Inflation bieten diese kurzfristigen Wertpapiere jedoch keine attraktive Rendite. Die Folge: Investoren bevorzugen andere Anlagen wie Aktien, Unternehmensanleihen oder Fremdwährungen. Diese Umschichtung ist keineswegs marginal, sondern hat erhebliche Auswirkungen auf die globalen Kapitalströme.
Dieses Phänomen erklärt zum großen Teil den aktuellen Boom der US-Aktienmärkte. Die Anleger, denen infolge der Sättigung des kurzfristigen Anleihemarktes wenig Optionen bleiben, investieren ihre Liquidität wieder in die großen Aktienindizes. Das befeuert die spektakuläre Rallye des Nasdaq und des S&P 500, die weit über das hinausgeht, was die wirtschaftlichen Fundamentaldaten rechtfertigen würden.
Dieser Mechanismus funktioniert wie eine Art versteckte, fiskalische quantitative Lockerung: Das Finanzministerium sorgt durch die Struktur seiner Anleiheemissionen dafür, dass Kapital aus dem Geldmarkt abgezogen wird, um risikoreiche Anlagen zu finanzieren. Der Anstieg der US-Aktienkurse ist daher weniger auf eine Verbesserung der Wirtschaftsaussichten zurückzuführen als vielmehr auf geschickt orchestriertes „Financial Engineering“ des Finanzministeriums und der Fed. Diese Entwicklung trägt automatisch zu einer Verringerung der Dollar-Nachfrage bei. Durch die massive Ausgabe sehr kurzfristiger Schuldtitel zwingt das Finanzministerium die Investoren, ihr Geld in Laufzeiten von nur wenigen Wochen anzulegen. Nach Fälligkeit dieser Wertpapiere wird die Liquidität schnell in andere, rentablere Vermögenswerte wie Aktien oder Unternehmensanleihen umgeschichtet. Mit anderen Worten: Anstatt in US-Staatsanleihen und damit im Dollar „gefangen” zu sein, fließen die weltweiten Ersparnisse wieder in risikoreiche Märkte.
Die Fed ihrerseits hat mehr als 1 Billion Dollar aus der Reverse Repo Facility (RRP) abfließen lassen. Normalerweise blieb dieses Kapital in der kurzfristigen Fazilität blockiert. Indem sie es freigibt und wieder in die Bankreserven einspeist, versorgt die Fed das Finanzsystem erneut mit Liquidität. Diese Maßnahme wirkt wie eine versteckte geldpolitische Lockerung, die Spannungen an den Finanzmärkten verringert und die amerikanische Währung weiter schwächt.
Darüber hinaus hält die Fed ihre Swap-Linien in Dollar mit den großen ausländischen Zentralbanken offen. Dadurch wird sichergestellt, dass europäische, japanische oder britische Banken weiterhin Zugang zu Finanzmitteln in Dollar haben. Dieses leicht verfügbare Angebot verhindert, dass der Dollar am Weltmarkt wieder an Wert gewinnt.
Schließlich verstärken die Signale der US-Politiker diese Dynamik noch. Die Debatten über ein mögliches Schuldenrückkaufprogramm oder eine Lockerung der Regulierung lassen eine neue Liquiditätswelle erwarten. Auch ohne konkrete Entscheidung reichen diese Andeutungen aus, um die Erwartungen einer Entspannung zu schüren und den Dollar weiter unter Druck zu setzen.
Durch die Kombination dieser Hebel – kurzfristige Emissionen, Lockerung des RRP, Swap-Linien und strategische Kommunikation – schwächt Washington den Dollar bewusst. Dies macht US-Treasuries für ausländische Investoren attraktiver und erleichtert ihre Platzierung, während gleichzeitig verhindert wird, dass die langfristigen Zinsen unter dem Druck der kolossalen Staatsverschuldung in die Höhe schnellen.
Konkret bedeutet dies: Wenn eine lokale Währung gegenüber dem US-Dollar aufwertet, sind weniger Euro, Yen oder Yuan erforderlich, um die gleiche Menge an amerikanischen Wertpapieren zu kaufen. Treasuries werden somit automatisch in der lokalen Währung günstiger, was die Nettorendite der Anlage verbessert.
Nehmen wir das Beispiel eines europäischen Anlegers, der US-Staatsanleihen im Wert von 100 Millionen Dollar erwerben möchte. Wenn der Euro gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt, muss er weniger Euro ausgeben, um dieselbe Position aufzubauen. Die Einstiegskosten sinken und die erwartete Rendite in Euro verbessert sich, ohne dass sich der Anleihekupon ändert.
Ein weiterer Vorteil liegt im Management des Wechselkursrisikos. Der Kauf von Treasuries bei einem relativ niedrigen Dollarkurs ist auch eine Wette darauf, dass er anschließend wieder steigen könnte. Wenn diese Aufwertung eintritt, profitiert der ausländische Anleger bei der Rückführung seines Kapitals von einem zusätzlichen Gewinn, der zur Anleiherendite hinzukommt.
Schließlich gibt es noch eine Wirkung auf globaler Ebene. Ein zu starker Dollar übt erheblichen Druck auf Schwellenländer aus, die ihre auf Dollar lautenden Schulden zurückzahlen müssen. Dies kann zu finanziellen Problemen führen und das globale System schwächen. Indem die USA den Dollar abwerten lassen, verringern sie dieses systemische Risiko, was ausländische Gläubiger beruhigt und sie dazu ermutigt, an den amerikanischen Markt zurückzukehren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der schwache Dollar einen starken Anreiz für internationale Investoren darstellt: Er senkt die Kosten für Staatsanleihen, erhöht die potenzielle Nettorendite und trägt zur Stabilisierung des globalen Finanzumfelds bei.
Kurzfristig vermittelt diese Strategie den Eindruck, dass alles in Ordnung sei: amerikanische Exporteure profitieren, ausländische Schuldner können aufatmen und die Aktienmärkte reiten auf der Welle der zusätzlichen Liquidität. Aber das ist eine trügerische Illusion. Denn je mehr die Währung an Wert verliert, desto leichter kann das Vertrauen ausländischer Gläubiger wieder verschwinden.
Diese Strategie birgt also ein hohes Risiko. Wenn große internationale Investoren – Zentralbanken, Staatsfonds oder Versicherungen – zu der Überzeugung gelangen, dass der Dollar bewusst nach unten manipuliert wird, gerät seine Glaubwürdigkeit als Reservewährung ins Wanken. Und ohne die Nachfrage großer internationaler Käufer ist das Gleichgewicht der amerikanischen Staatsverschuldung selbst gefährdet.
Das ist keine theoretische Annahme: In den 1970er Jahren, nach dem Ende von Bretton Woods und der Umtauschbarkeit des Dollars in Gold, war das Vertrauen in die US-Währung angeschlagen. Die ölproduzierenden Länder reagierten darauf mit der Forderung nach Ausgleichszahlungen durch einen drastischen Anstieg der Energiepreise, und mehrere Zentralbanken diversifizierten ihre Reserven mit nicht auf Dollar lautenden Vermögenswerten.
Heute ist dieses Szenario des Misstrauens mehr als eine bloße Hypothese: Es ist bereits im Gange, mit der schrittweisen Entdollarisierung der Devisenreserven zugunsten von Gold. Mehrere Zentralbanken – insbesondere in Asien, im Nahen Osten und in Lateinamerika – haben den Anteil des Dollars in ihren Reserven reduziert, um ihre Goldkäufe stark auszubauen. Dieser Wandel spiegelt einen impliziten Vertrauensverlust in die Stabilität und Neutralität der amerikanischen Währung wider. Wenn die Vereinigten Staaten den Eindruck erwecken, stark von der künstlichen Abwertung des Dollars abhängig zu sein, um ihre Schuldenlast noch verwalten zu können, wird sich dieser Trend wohl beschleunigen. Und die Geschichte zeigt, dass es lange dauert, die Glaubwürdigkeit in Währungsfragen wiederherzustellen, wenn sie erst einmal beschädigt ist.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.