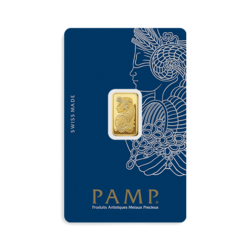Eine simple Aussage kann manchmal wie eine Zeitbombe wirken. Über hochrangige Politiker erklärte Deutschland, dass es sein in den USA gelagertes Gold zurück ins Inland holen wolle. Diese Ankündigung ist keineswegs nur ein PR-Gag, sondern spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen wider, die das internationale Finanzsystem heute durchläuft. Sie verdeutlicht vor allem die allmähliche Erosion der amerikanischen Hegemonie in Währungsangelegenheiten, wo das Vertrauen mittlerweile zunehmend schwindet.
In diesen unruhigen Zeiten ist Gold weit mehr als nur ein Metall. Es verkörpert vor allem wirtschaftliche Stärke und stellt für jede Nation eine Verbindung mit ihrer Vergangenheit und ihrer Souveränität dar. Alle Staaten versuchen sich angesichts der herrschenden Unsicherheit zu schützen – auf finanzieller Ebene spielt Gold diese stabilisierende Rolle. Diese Dynamik äußert sich im Kauf neuer Goldbestände, aber auch in der Kontrolle der Reserven, die ein Land bereits besitzt. Die wenigsten wissen, dass offizielle Goldreserven oft außerhalb des jeweiligen Landes aufbewahrt werden, z. B. in New York oder London, und zwar sowohl aus finanziellen als auch aus historischen Gründen (insbesondere aus Angst vor der Beschlagnahmung des Goldes durch die Nazis während des Zweiten Weltkriegs). Deutschland ist nach den USA das Land mit den größten Goldbeständen weltweit. Von den über 3.000 Tonnen befinden sich jedoch noch etwa 1.200 Tonnen im Wert von über 113 Milliarden Euro in den Tresoren der US-Notenbank Fed. Mehr als die Hälfte der übrigen Reserven lagert bei der Bundesbank in Frankfurt und ein kleiner Teil wird bei der Bank of England aufbewahrt.
Dieser Goldbestand wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Bretton-Woods-Systems aufgebaut. Durch einen beispiellosen Wirtschaftsaufschwung, der unter anderem durch den Schuldenerlass im Rahmen des Marshallplans ermöglicht wurde, konnte Westdeutschland dank seiner Exportüberschüsse umfangreiche Goldreserven anlegen. Aufgrund des Vertrauens in die USA und die amerikanische Allmacht deponierte Deutschland damals, wie die meisten europäischen Länder, einen beträchtlichen Teil der Bestände in New York. Einige hatten zwar eine gegenteilige Entscheidung getroffen und ließen das Gold, das sie zuvor in den USA gelagert hatten, wieder ins Inland transportieren, unter anderem Frankreich unter General De Gaulle. Dies blieb jedoch die Ausnahme und die Tradition wurde auch nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 fortgesetzt. Die Aufbewahrung von Gold in den Vereinigten Staaten bietet bestimmte Vorteile: Liquidität, Sicherheit, einfachen Zugang und ein implizites Bündnis mit der Atommacht USA. Diese Bestände garantieren außerdem, dass jede Zentralbank sie im Notfall in Dollar (oder eine andere harte Währung) umwandeln kann.
Doch Vertrauen ist wie die Demokratie ein zerbrechliches Gut, das jederzeit Risse bekommen kann. Geld, als das Gold über Jahrtausende hinweg anerkannt war, ist von dieser Regel nicht ausgenommen, da auch das Geld selbst auf Vertrauen beruht. Die Forderung Deutschlands nach der Rückholung seiner Goldreserven scheint daher in erster Linie eine politische Antwort zu sein. Wenn Deutschland beschließt, seine Goldreserven aus den USA abzuziehen, dann ist dies Ausdruck des schwindenden Vertrauens in seinen historischen Bündnispartner. Die USA drohen Europa heute auf allen Ebenen – wirtschaftlich (Handelszölle), militärisch (Austritt aus der NATO), energiepolitisch (Kauf von amerikanischem Schiefergas) – und die Regierung von Olaf Scholz zählt zu den Hauptbetroffenen. Hinzu kommen Zweifel an der tatsächlichen Existenz der in den Tresoren von Fort Knox gelagerten Goldreserven, die zuletzt 1953 vollständig geprüft wurden. „Vielleicht ist es da, vielleicht auch nicht“, kommentierte Elon Musk. Der Präsident der Vereinigten Staaten seinerseits bekräftigte: „Wir hoffen, dass in Fort Knox alles in Ordnung ist. Wir werden das legendäre Fort Knox besuchen und sicherstellen, dass das Gold dort ist. Wenn es nicht da ist, werden wir sehr enttäuscht sein“. In einer Welt, in der Bündnisse nur noch Fassade sind, wird die Überprüfung der tatsächlichen Präsenz des Goldes in den USA zu einer klaren Notwendigkeit.
Noch vor den neuen Zöllen, mit denen Europa belegt wurde, hatte Berlin diesen Schritt bereits vorbereitet. Im Jahr 2020 forderte Deutschland die Rückführung seines gesamten Goldes, um sich der Existenz der Bestände zu versichern. Der kürzlich von den USA begonnene Handelskrieg hat also lediglich einen bestehenden Trend beschleunigt. Für Deutschland ist dies eine wichtige Entscheidung, da Gold einen signifikanten Anteil der Vermögenswerte ausmacht, die die offiziellen deutschen Währungsreserven bilden. Seit dem Trauma der Hyperinflation zu Zeiten der Weimarer Republik in den 1920er Jahren nimmt das gelbe Metall einen zentralen Platz ein, da es eine greifbare physische Ressource darstellt, die im Gegensatz zur Papierwährung nicht zusammenbrechen kann. So macht Gold fast 70 % der deutschen Devisenreserven aus, während der Anteil in China nur 2 % und in der Schweiz nur 6 % beträgt.
Deutschland ist mit diesem Vorgehen jedoch keine Ausnahme. Es schließt sich damit Ländern wie Indien an, das kürzlich einen großen Teil seines Goldes zurück ins Inland geholt hat (was übrigens eine der größten Bewegungen seit 1991 war), oder auch den Niederlanden, die 2014 einen erheblichen Teil ihrer Goldreserven nach Amsterdam transferierten. Aber auch anderen Staaten, die sich dafür entschieden haben, ihre Reserven aus den USA abzuziehen, darunter Russland, Venezuela, die Türkei... alles Länder, deren Beziehungen zur größten Macht der Welt besonders belastet sind. Dass Deutschland eine solche Position einnimmt, zeigt also das Ausmaß der Spannungen zwischen Europa und den USA, zu einem Zeitpunkt, an dem Trump seinen Blick vom alten Kontinent abwendet und für sein eigenes Land eine Rückeroberung des Nationalstaats anvisiert.
Diese Entwicklung könnte weitreichende Folgen nach sich ziehen. Zwar befindet sich das weltweit größte Golddepot auch heute noch in den USA, mit New York an der Spitze (wo mehr als ein Viertel der weltweiten Goldreserven lagern). Das könnte sich jedoch schnell ändern. Wenn Deutschland diese Maßnahme umsetzt, würde dies als Warnsignal interpretiert, dem andere Nationen folgen könnten. Mehr als 30 Länder lagern einen Teil ihrer Goldreserven auch heute noch in den USA: Neben großen europäischen Akteuren wie Frankreich und Italien auch zahlreiche aufstrebende Mächte, und viele Staaten halten sich bedeckt, was den genauen Standort ihrer Bestände betrifft. Dies könnte zu einer weltweiten Bewegung führen, von deren Auswirkungen auch amerikanische Vermögenswerte nicht verschont blieben.
Die finanzielle Hegemonie der USA würde stark beschädigt werden. Bei ansonsten gleichen Bedingungen würden einige Länder, die US-Staatsanleihen halten, diese voraussichtlich abstoßen (obwohl die Märkte in den letzten Wochen erhebliche Verluste verzeichneten), wodurch die Anleihekurse sinken und die Schuldenkosten steigen würden. Bereits jetzt steigen die langfristigen US-Zinsen seit Trumps Ankündigungen zu den Zöllen wieder an, was im Widerspruch zu den von der Fed und dem Weißen Haus geäußerten Hoffnungen auf Kontrolle der Zinsentwicklung steht. Der Wert des Dollars, der eng mit den Staatsanleihen verknüpft ist, würde weiter sinken, was Importe verteuert und die Inflation anheizt. Die Fed könnte versuchen, den Schock abzufedern, indem sie massiv Anleihen aufkauft, wie sie es in der Vergangenheit und insbesondere während der Gesundheitskrise getan hat. Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Inflation bestünde jedoch die Gefahr, dass diese Strategie neue Ungleichgewichte schafft, die sich ebenfalls negativ auf den Dollar auswirken.
Zwar sind die Goldbestände der Zentralbanken weltweit – rund 2,7 Billionen Dollar – im Vergleich zum Umfang des US-Treasury-Marktes, der auf über 8 Billionen Dollar geschätzt wird, relativ bescheiden. Die Grunddynamik ist jedoch nachteilig für Washington, da die Entdollarisierung der Welt in vollem Gange ist. Viele Schwellenländer lösen sich durch den Kauf von Gold weiter von der amerikanischen Währung und China, die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, verringert sein Engagement im US-Finanzsystem kontinuierlich. Es gilt nun zu beobachten, wie Europa sich verhält: Sollten andere europäische Staaten nachziehen, die zu den wichtigsten Investoren in US-Wertpapiere zählen, könnte die Entscheidung Deutschlands letztlich die gesamte amerikanische Währungshegemonie in Frage stellen.
Gold seinerseits kann dieses Signal nur positiv aufnehmen. Obwohl eine Hausse des Dollars den Kurs des gelben Metalls kaum mehr beeinflusst, wirkt sich ein Rückgang des US-Dollars positiv auf den Goldpreis aus. Vor allem aber zeigt die Entscheidung eines Staates, sein Gold zurück ins Inland zu holen, einen deutlichen Vertrauensverlust gegenüber dem Verwahrer – den USA – aber auch den erklärten Willen, dem Edelmetall wieder größere Bedeutung beizumessen.
Die Welt bewegt sich also still und leise auf eine Wiederaneignung nationalen Reichtums zu, ganz im Gegensatz zu den Mythen der glücklichen Interdependenz, die im Zuge der Globalisierung verbreitet wurden. Die deutsche Entscheidung spiegelt sowohl die Rückkehr des Nationalismus als auch die Unsicherheit einer Welt wider, in der das Recht des Stärkeren alltäglich geworden ist. Mit der Neugestaltung des globalen Gleichgewichts wird Gold wieder zu dem, was es in Wirklichkeit immer war: nicht nur ein Wert-, sondern auch ein Machtspeicher. Wenn es Deutschland gelingt, seine gesamten Goldreserven zurückzuholen, könnte dies ein wichtiges Signal für das internationale Finanzsystem sein...
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.