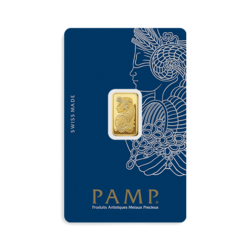Geld als Tauschmittel hat die Geschichte der Menschheit in äußerst unterschiedlichen Formen begleitet. Seit Jahrhunderten schon besteht eine anhaltende Spannung zwischen den Befürwortern von hartem Metallgeld und den Verfechtern von Kredit- oder Schuldgeld.
Die Entwicklung des Währungssystems seit dem 19. Jahrhundert (@julienchler)
— GoldBroker (Deutschland) (@Goldbroker_DE) August 31, 2022
➤ https://t.co/HMffSMk2JW#Gold #Silber #Währung #Geschichte pic.twitter.com/8g5oww8buD
Schon zu Zeiten Babylons existierten Hartgeld und Kreditgeld nebeneinander. Zu einem monetären Referenzstandard (Getreide, Vieh...) kamen immaterielle Schulden hinzu, die auf Tontafeln festgehalten wurden (das war vor rund 5000 Jahren der Ursprung der Schrift), und die durch ihre Verbreitung als Zahlungsmittel zu Kreditwährungen wurden. (Tauschhandel war dagegen lediglich eine Randerscheinung und wurde nie landesweit getrieben, außer in Zeiten schwerer Wirtschafts- und Währungskrisen).
Als sich die Entwicklung der Wissenschaften und der Wirtschaftssysteme beschleunigt, geht dies mit einem tiefgreifenden Wandel in Währungsangelegenheiten einher. Eine entscheidende Veränderung fand sechs Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung im antiken Griechenland statt: Die Welt verdankt der hellenischen Gesellschaft das Metallgeld in Form von Münzen. Ursprünglich wurden diese hauptsächlich aus Gold, aber auch aus Silber und selbst aus Bronze hergestellt.
Die finanzielle Revolution im Italien des 12. und 13. Jahrhunderts markiert anschließend einen weiteren Wendepunkt. Im späten Mittelalter kommt es zu einer großen anthropologischen Umwälzung, zu einem veränderten Verhältnis gegenüber der Zeit. Zeit wird zur Angelegenheit des Menschen und eine wahrhaft dynamische Wirtschaft entsteht. Die Perfektionierung der Buchhaltung und die Verbreitung der doppelten Buchführung lassen das Konzept des „Profits“ aufkommen, der bei Terminverkäufen erzielt wird, dank Forderungen, die durch Wechsel repräsentiert werden. Da sie verbreitet im Umlauf sind, werden diese Wechsel ebenfalls zu einer Kreditwährung. Bis zum Ende des Mittelalters entspricht ihr Volumen etwa 10 % des gesamten Geldbestands, wie Fernand Braudel gezeigt hat.
Eine solche der Zukunft zugewandte Gesellschaft nimmt mit der Akzeptanz von verzinslichen Darlehen den sogenannten Wucher wieder auf, d. h. die Etablierung eines zeitabhängigen Preises. Das Zinsverbot der Kirche und zahlreicher anderer religiöser Gesellschaften wird mit Hilfe verschiedener Methoden umgangen, unter anderem der Kreditvergabe in einer Währung und der Rückzahlung in einer anderen, was einen versteckten Gewinn aufgrund der verschiedenen Goldgewichte implizierte. Diese Praxis, die mit der protestantischen Reformation 1517 eine neue Bedeutung erhielt und im Falle von „produktiven Darlehen“ für legitim erklärt wurde, intensiviert die Kreditvergabe und ermöglicht eine Erhöhung des Geldbestands.
Vorhumanistische gesellschaftliche Bestrebungen und der damit einhergehende technische Fortschritt führen zu weiteren Veränderungen des Geldes. Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert ermöglicht die allgemeine Alphabetisierung sowie zwei bis drei Jahrhunderte später, während der Renaissance, das Aufkommen von Banknoten, d. h. einer neuen Form von Schuldgeld (bzw. Schuldscheinen), das in Gold konvertierbar ist.
Im Zuge der zunehmenden Abhängigkeit des Geldwesens vom Bankenwesen beginnen die Zentralbanken parallel zu Goldmünzen auch Schuldscheine in Umlauf zu bringen. Ihre Menge richtet sich nach den Goldbeständen, die die Zentralbanken als Reserve halten, damit die Privatbanken aus dem Umlauf einen Profit ziehen können.
Trotz dieser Erfindung existieren Metallgeld und Kreditgeld im 19. und 20. Jahrhundert weiterhin nebeneinander, wobei Gold weiterhin die dominierende Währung darstellt. Nach einer Reihe von Wirtschafts- und Finanzkrisen, die durch Bank Runs (umfassende Abhebungen von Bankeinlagen zur gleichen Zeit), aber auch durch Inflationskrisen verursacht wurden, führten die Großmächte Ende des 19. Jahrhunderts den Goldstandard ein, um den Wert ihrer Währungen an eine bestimmte Menge Gold zu binden und die Umlaufmenge der jeweiligen Währung entsprechend der vorhandenen Edelmetallreserven zu begrenzen.
Was anschließend geschah, ist allgemein bekannt: Die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts führten zu mehreren Währungsreformen, die dieses System bis 1945 aufrechterhielten. Danach diente nicht mehr Gold als Referenzwert, sondern der US-Dollar, bis der amerikanische Präsident Nixon 1971 schließlich das Ende des Goldstandards bekanntgab. Seitdem ist Geld nicht mehr in Gold umtauschbar und entspricht lediglich einem Schuldschein. Geld und Schulden sind seitdem zu zwei untrennbaren miteinander verwobenen Aspekten derselben Sache geworden.
Heutzutage wird Geld von den Geschäftsbanken bei der Gewährung eines Kredits aus dem Nichts geschaffen. Die erhaltenen Zinsen stellen die Geldschöpfung dar, da der geliehene Nennwert nach der Rückzahlung vernichtet wird. Eine Schuld ist also nicht direkt Geld, aber die Schöpfung von Geld erfordert die Vergabe von Krediten. In geringerem Umfang wird Geld auch in Form von „Zentralbankgeld“ geschaffen, z. B. wenn die Zentralbanken Anleihen auf dem Sekundärmarkt aufkaufen. Dieses Geld zirkuliert jedoch nur auf dem Interbankenmarkt oder in Form von Münzen und Banknoten (diese repräsentieren die Schuldscheine der Zentralbank und machen heute weniger als ca. 5% der gesamten Geldmenge aus). Seit dem Aufkommen des Internets und der Digitalisierung der Wirtschaft nimmt Geld hauptsächlich die Form von Buchungszeilen auf den Bankkonten jedes Einzelnen an.
Nach diesem kurzen historischen Rückblick kommen wir also zur ersten Frage: Welche Unterschiede bestehen zwischen Gold und Schuldgeld? Es lassen sich mehrere grundlegende Gegensätze feststellen. Auf den ersten Blick erfüllen beide die drei Funktionen des Geldes, die Aristoteles definiert hat: Wertspeicher, Recheneinheit und Tauschmittel. Wertspeicher, weil die Wirtschaftsakteure es lagern können (in Tresoren oder einem Depot im Falle von Gold bzw. auf einem Bankkonto im Falle von Schuldgeld), um es zu einem späteren Zeitpunkt zu verwenden. Recheneinheit, da mit ihm der Wert aller Waren und Dienstleistungen gemessen werden kann. Schließlich, und das ist die wichtigste Funktion, ist es ein Tauschmittel, da es von allen akzeptiert werden kann, um den Handel zu erleichtern (im Gegensatz zum Tauschhandel).
Während die beiden letztgenannten Funktionen seit jeher von beiden Währungen erfüllt werden, ist Schuldgeld kein vollwertiger Wertspeicher. Diese Funktion sollte dem Besitzer natürlicherweise die Möglichkeit geben, sein Geld zu behalten, ohne Gefahr zu laufen, dass dessen Wert im Laufe der Zeit abnimmt. Wenn aber das Volumen des Schuldgelds durch den Zinseffekt von selbst wächst („Geld, das Geld hervorbringt“, wie Aristoteles sagt), oder wenn die ausgegebene Geldmenge nicht der produktiven Wirtschaftstätigkeit entspricht, droht der Wertverlust des Geldes, das diese Funktion dann nicht mehr erfüllen kann. Das beobachten wir insbesondere anhand der starken und anhaltenden Abwertung der Währungen seit 1971. Um es mit Voltaire zu sagen: „Eine Papierwährung, die allein auf dem Vertrauen in die Regierung beruht, die sie druckt, kehrt am Ende immer zu ihrem inneren Wert zurück, d. h. zu Null.“
Dieser Mangel, der dem Schuldgeld innewohnt, aber von Historikern wie Wirtschaftswissenschaftlern nur unzureichend verstanden wird, begründet die Hauptwidersprüche zwischen dem Schuldgeld und Gold, der Metallwährung par excellence. Drei grundlegende menschliche Begriffe, die eng miteinander verbunden sind, trennen diese beiden Währungen: Vertrauen, Knappheit und Zeit.
Das Vertrauen. Im Gegensatz zu Gold, das einen Wert an sich hat (den Wert seines Gewichts), hat Schuldgeld keinen inneren Wert und beruht nur auf dem Vertrauen derer, die es verwenden. Ein 10-Euro-Schein beispielsweise hat nur den Wert, der ihm zuerkannt und vom Bankensystem festgelegt wird. Genauso wie das auf einem Bankkonto ausgewiesene Guthaben nur die Anerkennung der Schuld darstellt, die die Bank gegenüber ihrem Kunden hat. Denn eine Schuld ist von Natur aus ein Versprechen, das beide beteiligten Parteien (Gläubiger und Schuldner) bindet. Ein gleichzeitiger Erlass aller Schulden der Welt würde also dazu führen, dass fast alles Geld verschwindet.
Die Knappheit. Die Eigenschaft der Knappheit, die für eine Währung grundlegend ist, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Gold ist nur in begrenzter Menge vorhanden, während Schuldgeld in unbegrenzter Menge geschöpft werden kann. In der gesamten Geschichte der Menschheit wurden bisher etwa 200.000 Tonnen Gold gefördert, die heute in verschiedener Form weiterexistieren (Barren, Münzen, Schmuck...). Diese Menge ist von Natur aus begrenzt. Schuldgeld hingegen ist physisch unbegrenzt (oder fast unbegrenzt, wenn man berücksichtigt, dass die zur Herstellung von elektronischen Geräten verwendeten Metalle begrenzt sind). Dieser Unterschied führt zu einer Kluft zwischen den beiden Währungen in Bezug auf ihre jeweilige Funktion als Wertspeicher. Da Gold selten ist, bleibt sein Wert theoretisch neutral und kann im Laufe der Zeit sogar zunehmen. Im Gegensatz dazu besteht bei Schuldgeld die Gefahr, dass es an Wert verliert, wie oben erläutert.
Zeit ist der wichtigste Faktor in diesem Vergleich. Gold ist unveränderlich, unvergänglich und bewahrt seine Eigenschaften auch über lange Zeiträume hinweg. Da das Edelmetall nicht zerstört wird, stellt es eine dauerhafte Währung dar. Im Gegensatz dazu wird Schuldgeld annulliert, sobald eine Schuldenrückzahlung erfolgt. Denn wenn ein Kredit, für den neues Geld geschöpft wurde, sein Fälligkeitsdatum erreicht, wird das Geld vernichtet und nur die Zinsen bleiben als Geld erhalten (die in diesem Zeitraum übrigens selbst durch die Schulden eines anderen bezahlt wurden).
Schuldgeld und Gold unterscheiden sich also in wesentlichen Punkten. Der Übergang von einer Währung zur anderen erfolgte allmählich im Laufe der Geschichte und beschleunigte sich aufgrund einer tiefgreifenden Umwälzung, die zu einer Neudefinition unseres Verhältnisses zur Zeit führte. In der durch den Warenhandel geprägten Gesellschaft hat sich eine Währung durchgesetzt, die eine enge Brücke zwischen Gegenwart und Zukunft knüpft (Schuldgeld), um ein wachstumsbasiertes Wirtschaftsmodell zu nähren und zu dessen kontinuierlicher Entwicklung beizutragen. Früher wurde Geld als harte Währung (Gold, Silber, Bronze) vom Staat ausgegeben, während es heute sowohl von privaten Institutionen als auch von Zentralbanken, deren Entscheidungsträger nicht demokratisch legitimiert sind, aus dem Nichts geschaffen wird. All diese Themen sind eine nuancierte Diskussion wert.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist gestattet, sofern sie alle Text-Hyperlinks und einen Link zur ursprünglichen Quelle enthält.
Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.